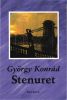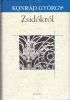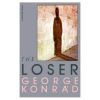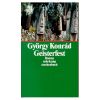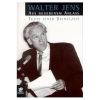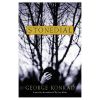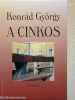Legfrissebb kiadás

|
Falevelek a szélben Magvető kiadó, 2017 |
Sonnenfinsternis- Süddeutsche (Karl-Markus Gauss, Süddeutsche Zeitung, 17.09.2005)
Kapcsolódó könyv:
Sonnenfinsternis auf dem Berg - Suhrkamp, 2005
Sonnenfinsternis auf dem Berg - Suhrkamp, 2005
Zur Verfügung gestellt von der
Süddeutsche Zeitung, 17.09.2005
Ein wenig verweilen möchte ich schon Da hat einer auf allen Podien gesessen und schreibt doch ein gutes Buch: György Konráds „Sonnenfinsternis“
Da veröffentlicht einer Buch um Buch, und seine Bewunderer wie Verächter meinen ihn längst zu kennen. Und dann legt er mit über siebzig Jahren einen „autobiographischen Roman“ vor, und man erkennt schon nach ein paar Seiten, dass es diesen Schriftsteller immer noch zu entdecken gilt. Vielleicht beginnt mit „Sonnenfinsternis auf dem Berg“ so etwas wie das lebensweise Alterswerk von György Konrád, der den einen als Verfasser luzider Essays und weitgespannter Romane teuer, den anderen als des „Kongresseuropäers“, der überall auftaucht und zu allem etwas zu sagen hat, einigermaßen verdächtig geworden war.
Es ist merkwürdig, wie Konrád, der in den fünfzehn Jahren auf den Symposien der Intellektuellen und den mit Geist nur notdürftig veredelten Bühnen der Macht schier omnipräsent schien, sich in seinem neuen Roman ganz anders entwirft. Er deutet sich da selbst glaubhaft als Mann, der „keine Rollen im öffentlichen Leben“ anstrebte und sich „keine Podien unter den Füßen“ wünschte, sondern sich aus Gewohnheit und Erfahrung abseits zu halten pflegte und nach seinem Garten, dem Tisch in der Küche, dem kleinen Arbeitszimmer sehnte.
Tatsächlich, bis über sein fünfzigstes Jahr hinaus hat Konrád in der Öffentlichkeit, auch in der literarischen, keine Rolle gespielt. Nicht aufzufallen, einzig dies verhieß während der faschistischen Jahre dem 1933 in Debrecen geborenen, in einem Dorf aufgewachsenen Sohn jüdischer Eltern Rettung vor der ihm zugedachten Vernichtung. Wie es ihm gelang, dieser durch eine Kette von Zufällen zu entrinnen, darüber hat er zuletzt in dem Roman „Glück“ unerbittliche Auskunft gegeben. Mit „Sonnenfinsternis auf dem Berg“ führt er seine über das Jahr 1945 bis zur Sonnenfinsternis des Jahres 1999, mit der ihm sein Jahrhundert, das zwanzigste mit seinen Verheerungen und Verwerfungen, zuende ging.
Die Rückschau gerät verblüffend milde. Genau genommen, kannte Konrád bis zum unverhofften Zusammenbruch des realen Sozialismus von 1989 nur vier Jahre einer prekären Normalität. Das waren die Jahre zwischen 1945, als seine verschleppten Eltern, gezeichnet, um Jahre gealtert, als Überlebende in ihrem Dorf wieder auftauchten, und 1949, als der Stalinismus der „kleinen zivilen Pause“ ein rigoroses Ende setzte. Danach findet sich der Gymnasiast, der eben erst gelernt hat, sich zu behaupten, bald wieder an den Rand gedrängt. Spitzel sitzen sogar in der Schulklasse, an der Universität wird er zwar zugelassen, aber darf nicht studieren, wofür er sich entschieden hatte, dann den erlernten Beruf eines Gymnasiallehrers für Ungarisch nicht ausüben, später nicht publizieren, was er schreibt, und endlich nicht einmal für die Schublade schreiben, was er möchte.
In der Schule der Lebenskunst
Die politische Polizei dringt immer wieder in seine Wohnungen ein, durchsucht die Quartiere seiner Freunde und Verwandten nach Abschriften seiner Manuskripte und nimmt sie, wenn sie welche gefunden hat, in Verwahrung, weil sie von ihr als fortgesetzter Verstoß gegen die sozialistische Ordnung gewertet werden. Kurz, Konrád war es nicht vergönnt, in leidlich gesicherten Verhältnissen seine Existenz mit dem zu bestreiten, wofür er sich berufen wähnte. Er sieht das nachträglich völlig unheroisch, aber auch frei von dem Ressentiment, durch die politischen Verhältnisse um sein Eigentliches betrogen worden zu sein. „Dissident bin ich nur gezwungenermaßen geworden“, schreibt er, denn „für die oppositionelle Arbeit war ich zu faul und zu ungeschickt“. Gleichwohl wird er zum berühmtesten ungarischen Dissidenten, und wenn er seinen Lebensweg in diesem die Chronologie mit Vor- und Rückgriffen, Porträts und Reflexionen immer wieder aufbrechenden Roman noch einmal nachgeht, nimmt man ihm ab, dass er nichts weniger sein wollte als dies.
Was ihn von vielen seiner Mitstreiter unterscheidet, ist die geradezu rätselhafte Fähigkeit, aus allem, was über ihn verhängt wird, das Beste zu machen: „Nachdem ich im Alter von dreiundvierzig Jahren von überall entfernt worden war und mir keinerlei Amtsgeschäfte mehr oblagen, mußte ich auch die Gesellschaft nervender Zeitgenossen nicht ertragen, obwohl mir das nicht sonderlich schwer gefallen war.“ Da man ihm nacheinander die Möglichkeit genommen hat, als Lehrer, Schriftsteller, als Mitarbeiter der Budapester Sozialfürsorge, als Stadtsoziologe zu wirken, beschließt er, die Ausgrenzung nicht als Fluch, sondern als Chance zu begreifen, um die Dinge geduldig zu betrachten, seine Arbeit ohne Blick auf Erfolg, Wirkung, Ruhm zu tun – und sich in der hohen Schule der Lebenskunst auszubilden. Die Ära der Dissidenz erhält in der Lebensbilanz fast arkadische Züge: Da ist der flanierende Stadterkunder, der Freund vorstädtischer Cafés und Wirtshäuser, der leidenschaftliche Familiengründer.
Überhaupt: die Familie! Eingezeichnet in das Panorama seines Lebens ist eine große Liebeserklärung an die Eltern, an den Vater, einen Menschen voller „Harmlosigkeit“, ja von einer „gewissen Einfalt“, und die gewitzte, lebenstüchtige Mutter. Fein ausgestaltet sind auch die Liebesgeschichten mit den drei Ehefrauen, die Konrád hatte und die sich geradezu wundersam gut miteinander zu verstehen scheinen. Jedenfalls ist ihm im letzten Jahr des 20. Jahrhunderts das Glück beschieden, mit der dritten fast so junge Kinder zu haben, wie er über die anderen bereits Enkelkinder bekommen hat: „Auf ganz traditionelle Weise habe ich den einfachsten Sinn in meinen Kindern und Enkeln gefunden, denen zuliebe ich hier, solange es möglich ist, noch ein wenig verweilen möchte.“
Das Buch ist durchsetzt mit lichten Formulierungen über das Altern, die Freude am Leben, die es ohne das Bewusstsein der Endlichkeit, ja des nahenden Endes nicht gäbe. Das mutet, wenn Konrád die Familiengeschichte im Schatten von Auschwitz skizziert, durchaus verstörend an. Doch ist der ganze Roman eine einzige Apologie des Lebens und des Glücks, der Kraft, sich selbst wider missliche Verhältnisse nicht verbittern zu lassen: „Selbst der körperliche Verfall, der mich erwartet, selbst die Serie an Niederlagen während des Altwerdens sind interessanter als das Jenseits . . . Diese Welt – zusammen mit all dem, was in ihr ist – ist noch immer die beste von allen existierenden Welten. Alles Leben ist besser als das Nichts . . .“
KARL-MARKUS GAUSS